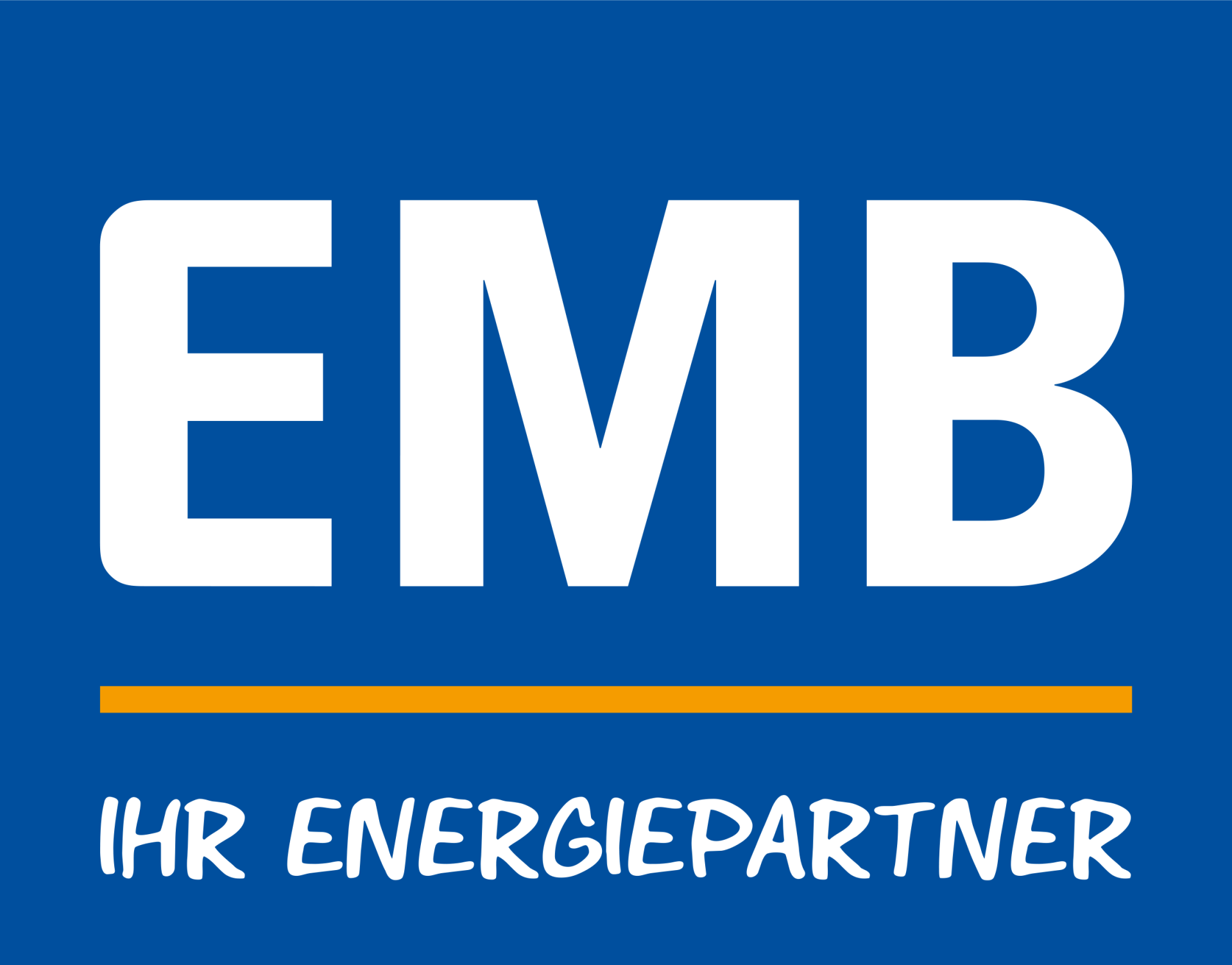Geschichte
Michelsdorf und seine Geschichte - Zur Geschichte der zauchischen Dörfer bis zum Jahre 1860
Auszug aus der Broschüre "825 Jahre Michelsdorf - Berichte und Erzählungen aus der Geschichte des Zauche Dorfes"
"Bis vor einigen Jahren war man sich nicht sicher, wann Michelsdorf erstmals urkundliche Erwähnung fand, bis sich der damalige Bürgermeister Herr Wolfgang Griessbach am 30.08.1988 an einige Archive des Landes wandte, um die genaue Jahreszahl zu erfahren.
War es 1190 oder 1193? Es war nun doch langsam das genaue Datum von Nöten, denn man wollte sich auf das große Jubiläum, die 800-Jahr-Feier von Michelsdorf, vorbereiten. So wurde er nun im Staatsarchiv Potsdam, welches sich in Sanssouci in der Orangerie befand, fündig.
Der Oberarchivrat und Direktor des Archivs, Professor Doktor Beck, teilte dem Bürgermeister in einem Schreiben vom 02.11.1988 mit, dass unser Ort erstmals im Jahre 1193 urkundlich genannt wurde. Er schrieb weiter, dass die Originalurkunde die kein Tagesdatum nennt, 1945 verloren gegangen ist. Deren Inhalt findet sich jedoch in einer Veröffentlichung einer Urkundenpublikation des 19. Jahrhunderts wieder."
Damals wurde es (Michelsdorf) vom brandenburgischen Markgrafen Otto II. dem Kloster Lehnin geschenkt.[4] Der Name ist mit ziemlicher Sicherheit als Dorf eines Michael zu erklären. Der Personenname Michel von Michael ist biblischer Herkunft. Die Dorfkirche in Michelsdorf hat ein Michael-Patrozinium. Sie kann dem heiligen Michael als Patron des Ortsgründers geweiht sein, aber auch eine Benennung des Dorfes nach dem Michaelspatrozinium ist nicht völlig auszuschließen (Reinhard E. Fischer, Namenbuch, S. 86). Allerdings wäre dann vielleicht eher ein Ortsname Michelskirchen o. Ä. zu erwarten. Von der Siedlungsstruktur her ist Michelsdorf ein Gassendorf mit späteren Erweiterungen. (Wikipedia)
Politische Geschichte
Der Ort gehörte von 1193 bis 1542 zum Kloster Lehnin, von 1543 bis 1872 zum Amt Lehnin. 1375 lag der Ort in der historischen Landschaft Zauche, aus der sich im Laufe des 17. Jahrhunderts der Zauchische Kreis herausbildete. 1816/7 wurde dieser mit dem ehemaligen kursächsischen Amt Belzig zum Zauch-Belzigschen Kreis (später Kreis Zauch-Belzig) vereinigt. In der Kreisreform von 1952 wurde der Landkreis Zauch-Belzig aufgelöst, Michelsdorf kam zum Kreis Brandenburg-Land. 1992 schloss sich Michelsdorf mit anderen Gemeinden zum brandenburgischen Amt Lehnin zusammen, das 2002 mit der Bildung der neuen Gemeinde Kloster Lehnin wieder aufgelöst wurde. Seither ist Michelsdorf ein Ortsteil der Gemeinde Kloster Lehnin.
(Wikipedia)
Weinberg
Westlich und nordwestlich vom Kloster liegen drei Orte mit Weinbau, darunter Michelsdorf: Es gehörte bereits seit 1193 zum Klosterbesitz und ist nur drei Kilometer südwestlich vom Kloster entfernt. Einziger Beleg für den Weinbau dort ist eine Karte von der Feldmark Michelsdorf, die zur Separation 1819 angefertigt worden war. Auf ihr ist östlich des alten Ortskernes ein Flurstück
mit dem Namen »Der Weinberg« eingetragen.
Quelle: 209 BLHA, Rep. 24, Generalkommission (Karten), Kreis Zauch-Belzig Nr. 166 Michelsdorf;
Meßtischblatt Nr. 3642 - Lehnin - Landesaufnahme von 1880


Das Messtischblatt von 1880 hat diese Angaben übernommen. Die Preußische Flurnamensammlung gibt die Größe des Flurstückes mit 70 Morgen an und enthält die Anmerkung, dass die Lehniner Mönche hier Wein angebaut hätten. 210
Vom Klosterhof Kaltenhausen ist es nur eine kurze Wegstrecke. Nach Darstellung von Dr. Reindl von 1906 soll hier 1902 noch eine Rebfläche von vier Hektar im Ertrag gestanden haben. 211
Das Flurstück ist heute aufgeforstet. Der zweite Ort ist Netzen: Nach 1241 wurde es stückweise an das Kloster angegliedert. Hier gibt es ein Flurstück von drei Hektar Größe mit der Bezeichnung »Weinberg«. 212
Und schließlich Trechwitz: Das Dorf ist 1191 vom Kloster erworben worden. Hier gibt es nordöstlich des Ortes neben dem Galgenberg ein Flurstück mit der Bezeichnung "Weinberg"
210 GStA P K, X. HA Rep. 16, Flurnamensammlung, Nr. 6 Zauch-Belzig Il, Michelsdorf
211 REINDL 1906, S. 82.
212 HAVELLAND UM WERDER, S. 114, 192.
Mühlen
In Michelsdorf gab es früher einmal zwei Windmühlen und eine Motormühle.
(von Renate Schulze in "825 Jahre Michelsdorf")
In Wikipedia heißt es:
„1845 verkauft Mühlenbesitzer Kauschke die Bockwindmühle mit dazugehörigem Wohnhaus, Stallung und Garten in Michelsdorf.
Der Wohnplatz Windmühle lag nordöstlich des Ortskerns an der Straße nach Lehnin auf dem Mühlberg.
Die 2. Getreidemühle lag an der Rädeler Straße, nahe der Abzweigung von der Chausseestraße (etwa auf der Höhe der Rädeler Straße 45)“
Zu der 2. Mühle sind keine weiteren Informationen bekannt, außer der Vermutung, dass diese Mühle in der Nähe der damaligen Bäckerei Pollert stand. Das belegt auch die alte Landkarte von 1882, auf der zwei Windmühlen eingezeichnet sind.
Ziegeleien
Durch die Preußischen Reformen im 19. Jahrhundert (1806-1918) hatte das aufstrebende Bürgertum, welches teilweise mehr Kapital besaß, als der preußische Adel, die Möglichkeit Grundeigentum aus angestammten Besitztümern zu erwerben. Es entstanden um Lehnin bürgerliche Güter und Ziegeleien. In Michelsdorf entstanden um 1850-1870 zwei Ziegeleien von Herrn Schulze und Familie Britz und ein Gutsbesitz durch den Kaufmann Blume aus Berlin.
Geschäfte
Einblicke in das wirtschaftliche Leben eines Dorfes
Michelsdorf war über viele Jahrzehnte hinweg geprägt von einer lebendigen Dorfgemeinschaft, in der vielfältige Geschäfte und Handwerksbetriebe zu zentralen Treffpunkten und Versorgungspunkten wurden. Im Folgenden werden einige der wichtigsten Einrichtungen und ihre Entwicklung vorgestellt.
Gasthöfe
Von Schifferbällen und einer Saalschlacht
Michelsdorfer Senioren erinnern sich und erzählen Geschichten rund um die Gastronomie des Dorfes.
Was von den bewegten Zeiten geblieben ist? Erinnerungen. An die Ziegeleien, das Gut, die LPG, den Obstbau und die Gaststätten in Michelsdorf.
Schule und Kindergarten
(Hans Hein, Michelsdorf OL i. R)
Auch in Michelsdorf gab es eine Volksschule. Der Ort leistete sich zwei Schulgebäude. Die Alte Schule befindet sich in der Dorfstraße (heute Alte Dorfstraße) direkt neben der Michaeliskirche. Der rote Backsteinbau setzt sich deutlich in Höhe und Größe von den umliegenden Wohngebäuden ab. Er umfasst den Keller, zwei Etagen und ein ausgebautes Dachgeschoss.
Direkt an der Schule gab es einen Schulhof. Dieser lag zwischen dem Schulgebäude und der Kirche. Die älteren Schüler nutzten auch die Straße zwischen Schule und ungefähr Höhe Gaststätte Boche zur Pausenerholung.
Neben der alten Schule in der Dorfstraße wurde in Michelsdorf in der Tornower Straße ein neues Schulgebäude gebaut. Sicher machte es die Anzahl der Schüler notwendig ein zweites Gebäude zu errichten. Es ist ebenso ein zweigeschossiger Klinkerbau wie das Haus in der Dorfstraße.
Feldsteinkirche
Die evangelische Dorfkirche Michelsdorf ist eine romanische Feldsteinkirche aus dem 12. Jahrhundert in Michelsdorf. Die Kirchengemeinde gehört zum Pfarrbereich Lehnin im Kirchenkreis Mittelmark-Brandenburg der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologische Landesmuseum (BLDAM) weist in seiner Datenbank darauf hin, dass die Kirche erst 1946 das Patrozinium des heiligen Michael erhielt.
Die Kirche steht am nordöstlichen Rand des Dorfes auf einem erhöhten Grundstück, dass nicht eingefriedet ist. Diese vergleichsweise ungewöhnliche Lage könnte, so Theo Engeser und Konstanze Stehr, damit zusammenhängen, dass der Ort nach dem Dreißigjährigen Krieg annähernd 50 Jahre wüst lag.
(Wikipedia)
Straßenansichten Gestern und Heute
Der Wandel eines Dorfes im Lauf der Zeit
Eine Betrachtung über Veränderung und Beständigkeit
Es ist tatsächlich faszinierend, wie sich das Gesicht eines Dorfes im Verlauf der Jahre immer wieder neu formt. Wo einst einfache Dorfkaten mit einer schwarzen Küche im Inneren das Bild bestimmten, recken sich heute neue oder umgebaute Wohnhäuser in den Himmel, und doch bleibt irgendwo der verwitterte Brunnen am Dorfplatz, der stumme Zeuge von Generationen bleibt.
Jede Epoche hinterlässt ihre Spuren: Mal wächst ein neues Wohngebiet am Ortsrand, mal wird die alte Scheune abgerissen, um einem Spielplatz Platz zu machen. Gassen, die früher von Pferdehufen widerhallten, sind nun gesäumt von parkenden Autos, und Laternenlicht verdrängt nach und nach das warme Flackern der Öllampen.
Doch zwischen all diesen Veränderungen gibt es Konstanten, die dem Wandel trotzen – sei es die uralte Linde vor dem alten Schulhaus, der Kirchturm, der über die Dächer wacht, oder die in den 70iger Jahren asphaltierten Straßen prägen. Und so wird sichtbar, dass das Dorf nicht nur ein Ort, sondern ein lebendiges Gefüge ist, das Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander verwebt.
In seiner Veränderung liegt eine stille Schönheit: Jede Generation trägt einen Teil bei, schreibt ein weiteres Kapitel in die Geschichte des Ortes und macht das Dorf zu dem, was es heute ist – und morgen vielleicht schon wieder anders sein wird.