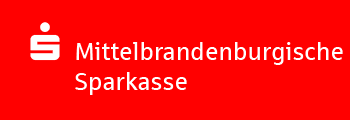Weinberg
Westlich und nordwestlich vom Kloster liegen drei Orte mit Weinbau, darunter Michelsdorf: Es gehörte bereits seit 1193 zum Klosterbesitz und ist nur drei Kilometer südwestlich vom Kloster entfernt. Einziger Beleg für den Weinbau dort ist eine Karte von der Feldmark Michelsdorf, die zur Separation 1819 angefertigt worden war. Auf ihr ist östlich des alten Ortskernes ein Flurstück
mit dem Namen »Der Weinberg« eingetragen.
Quelle: 209 BLHA, Rep. 24, Generalkommission (Karten), Kreis Zauch-Belzig Nr. 166 Michelsdorf;
Meßtischblatt Nr. 3642 - Lehnin - Landesaufnahme von 1880
Unmittelbar östlich an die Ortslage von Michelsdorf grenzend, erhebt sich ein etwa 72m hoher Hügelkomplex, der sich in Mühl- und Weinberg unterteilt. Insbesondere wenn man auf der Landstraße 86 aus Richtung Golzow kommt, kann man die teilweise waldfreien Hügel hinter dem Dorf von weitem sehen.
Der Mühlberg ist der nördliche Hügel, auf dessen Kuppe Pflaumengebüsche und einzelne Eichen stehen. Der südliche Hügel, der Weinberg, wurde zu großen Teilen zur Sandgewinnung abgebaggert. Die Bezeichnung Weinberg deutet auf die frühere Nutzung solcher exponierten Hügel und Kuppen zum Weinanbau, der insbesondere durch die Zisterzienser in der Region gefördert wurde. Große Teile des Gebietes sind im Eigentum der Kirche. Die zu früheren Zeiten meist völlig waldfreien Hügel hatten aufgrund ihrer Lage und Exposition ein besonders trockenes und warmes Klima, das nicht nur dem Weinanbau zugute kam.
Heute gehört der Weinberg zu einem von der EU geförderten FFH - Gebiet. Siehe auch Projekte/Weinberg


Yucca
Eine Kuriosität sind viele alte Yuccas (hier gibt es nähere Infos) in dem Kiefernforst auf der Südseite des Weinbergs. Diese Pflanzen stehen nicht unter Naturschutz und stammen aus Nordamerika. Sie wurden in den zwanziger und dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts als Versuchspflanzung der IG Farben zur Fasergewinnung dort angebaut. Von diesen Pflanzen stammen auch einige der Sortenselektionen des berühmten Potsdamer Staudenzüchters Karl Foerster. Diese robusten Pflanzen zieren auch heute noch auffällig viele Vorgärten in Michelsdorf, ein Zeugnis dafür, dass nicht nur Karl Foerster sich dort bediente.

INDUSTRIELLER ANBAU
In den zwanziger und dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts betrieb die IG Farben, das damals größte deutsche Chemieunternehmen, großflächige Yucca-Kulturen für industrielle Zwecke in Deutschland. Die Yucca-Kulturen in Baden, Bayern, Hessen und Sachsen umfassten im Jahre 1924 etwa zwei Millionen Pflanzen welche noch bis Ende des Zweiten Weltkriegs, z. B. im Taunus bei Frankfurt am Main als Faserlieferanten für Jute und Bast auf hektargroßen Flächen angebaut wurden. Die wirtschaftlichen Erwartungen an die Produktion von Fasern, Geweben, Seilen und Bindemitteln haben sich offensichtlich nicht erfüllt, was möglicherweise auch mit der Auflösung der IG Farben nach dem Krieg zusammenhängt.
Ohne die Verdienste FOERSTER´s schmälern zu wollen – denn ohne ihn wären hierzulande wohl erheblich weniger „Gartenyuccas“ verbreitet – sei jedoch erwähnt, dass es sich bei seiner Arbeit „lediglich“ um die Auslese und Vermehrung von Pflanzen mit bestimmten habituellen Erkennungsmerkmalen handelte und nicht um Kreuzungen bzw. Hybriden.
FREUNDSCHAFTSINSEL POTSDAM
Zur Bundesgartenschau 2001 in Potsdam wurde die Freundschaftsinsel zum Andenken an Foerster umgestaltet. Zuvor wurden in einer groß angelegten Aktion alle Foerster-Sorten von Fachleuten gesichtet, auf der Freundschaftsinsel ausgepflanzt und mit seinen Sortennamen gekennzeichnet. Leider existieren nur Beschreibungen der Pflanzen durch FOERSTER, sodass bezüglich der Dokumentation bzw. der Zuordnung mit den richtigen Sortennamen zu den jeweiligen Pflanzen ein Fragezeichen gemacht werden muss. Zwei Besuche der Freundschaftsinsel, in den Jahren 2004 und 2011, offenbarten einige Verwechslungen. Letztendlich
können durch die verantwortlichen Gärtner dort lediglich drei alte FOERSTER-Sorten als dokumentiert gelten.
Der Name Karl Foerster wird im Allgemeinen mit Blütenstauden und Gräsern in Verbindung gebracht.
Nur wenigen ist bekannt, dass sich dasBornimer Pflanzengenie auch für die Einführung von „Palmen“ interessierte. Gemeint sind die zu den Agavaceae gehörenden Fädigen Palmlilien, Yucca filamentosa. Um 1930 wurde versucht, die deutsche Wirtschaft unabhängiger von Rohstoffimporten zu machen. Das betraf auch die Sisalfaser. Eine „Arbeitsgruppe“, zu der Karl Foerster hinzugezogen wurde, sollte prüfen, inwieweit sich aus den Blättern von Yucca filamentosa eine haltbare Pflanzenfaser herstellen ließe.
An mehreren Orten in Deutschland wurden Versuchspflanzungen angelegt; in Brandenburg auf dem Gut Bornim (heute Leibnitz-Institut für Agrartechnik) und auf Feldern des Klosters Lehnin. Großflächig wurden Yucca Sämlinge aufgepflanzt, deren Herkunft heute nicht mehr nachvollziehbar ist. Nach einigen Jahren endeten die Versuche erfolglos. Die bepflanzten Flächen sollten der landwirtschaftlichen Nutzung zurückgeführt werden. Karl Foerster nutzte die Gunst der Stunde und bat darum, vorher in den Yucca-Beständen ihn interessierende Einzelpflanzen auslesen zu dürfen. Er wusste wohl, das keinem Staudengärtner in Deutschland so schnell wieder ein derartiges „Selektionspotential“ geboten wird. Denn die aus dem Südosten Nordamerikas stammenden Yucca sind, um keimfähigen Samen anzusetzen, auf die Befruchtung durch eine spezialisierte Motte angewiesen, die es in Europa nicht gibt.

Es gelang eine größere Anzahl ausgesuchter Pflanzen in der Bornimer Gärtnerei aufzupflanzen und sie durch die Kriegs-
und Nachkriegswirren zu bringen. Im Katalog von 1957 kündigte Foerster erstmals Sorten an, die er schon 1950 benannt hatte: 'Schellenbaum', 'Schneefichte' und 'Schneetanne'. Später kamen noch 'Glockenriese' und ein halbes Dutzend weiterer Sorten hinzu, die aber kaum über die Grenzen der Gärtnerei verbreitet wurden.
Als um 1960 die Nachfrage die Kapazität der Yucca-Vermehrung deutlich übertraf, erinnerte sich Foersters Altmeister Paul Bolz an die Pflanzen in Lehnin (Michelsdorf,d.Red.). Diese waren, anders als die Versuchsfelder in Bornim, nicht untergepflügt worden und standen nun nach dreißig Jahren mitten in einem märkischen Kiefernwald. Ein Gärtnertrupp erhielt den Auftrag, von dort Pflanzen zu beschaffen. Erneut standen
Yucca-Sämlingspflanzen zur Verfügung, aus denen die Sorte 'Eisbär' herausgefiltert werden konnte. Sie kam 1977 in den Han-
del und war in der DDR eine weitverbreitete Sorte mit fast reinweißen Blüten.
Karl Foerster (1874-1970) war Staudenzüchter und Gartenphilosoph.
Text: Dr. Konrad Näser & J. Relf